

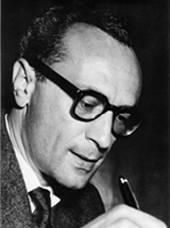
Roman Haubenstock-Ramati
Cantando
Kurz-Instrumentierung: Fl, Schl, Hf, Cel, Klav, Vc
Dauer: 20'
Instrumentierungsdetails:
Flöte (+Afl(G))
Harfe
Celesta (+Cemb)
Klavier
Schlagzeug: Vibraphon, Marimbaphon, Röhrenglocken, 3 Gongs (klein, mittel, groß), 3 Hängebecken (klein, mittel, groß), Hi-hat, 4 Almglocken (Cow bells), Glas-chimes, Metal-chimes, Wood-chimes
Violoncello
Das Stück ist
im Prinzip ein Mobile innerhalb eines vorgegebenen Rahmens mit beweglichen
Elementen, oder besser: es wird zum Mobile, denn der Beginn, quasi eine
Exposition, ist als Stabile disponiert. Daraus lösen sich allmählich kurze
Phrasen und Strukturen, die sich mehr und mehr der Form des Mobiles nähern.
Schließlich werden diese Strukturen in einer Art Coda vollends zum Mobile.
Dieses Mobile ist als variable Form mit einem Vorgang vergleichbar, nach dem
man mit einem bestimmten eingegrenzten Repertoire von Worten eine immer wieder
neue Geschichte erzählen kann. Pro Aufführung wird sich das ausführende
Ensemble gewiss jeweils einer bevorzugten Geschichte zuwenden.
In diesem
Mobile werden Geräusche und Klangmixturen einzelner Instrumente miteinander
verknüpft. Daraus ergibt sich ein vibrierendes Klangkontinuum, hier nicht als
Klangband zu verstehen, sondern als gleichsam permanenter Klangcharakter. Die
Rhythmik verschiebt sich ständig, bleibt also mehrdeutig. Das Stück wirkt wie
ein poetisch[-]lyrisches Klangfarbenspiel. Die darin eingenisteten
Mikrostrukturen erleben zwar zahlreiche Wiederholungen, verändern aber trotzdem
in einem fort das harmonische respektive das vertikale Bild der Musik.
Insgesamt ist der Zeitablauf genau disponiert, vor allem sind dies die
Zeitproportionen innerhalb der Einzelelemente, aus denen das Stück sich
aufbaut. Es ist, einem zarten, fragilen Gewebe vergleichbar, in der Nähe jener
Klangwelt angesiedelt, wie sie Haubenstock-Ramati
in seinen Nocturnes kultiviert hat. Cantando
wurde 1984 im ORF-Funkhaus Wien vom „Ensemble 20. Jahrhundert“ unter Peter
Burwik uraufgeführt.
Lothar Knessl
