

Franz Schmidt
Das Buch mit 7 Siegeln
Kurz-Instrumentierung: 3 3 3 3 - 4 3 3 1 - Pk, Schl, Org, Str
Dauer: 110'
Vorwort von: Otto Brusatti
Klavierauszug von: Franz Schmidt
Interpretationshinweise von: Franz Schmidt
Übersetzer: Martin Lindsay
Widmung: der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien zur Feier des 125-jährigen Bestandes gewidmet
Chor: SATB (große Besetzung)
Solisten:
Sopran
Alt
Tenor
Bass
Rollen:
Johannes - Heldentenor
Sopran
Alt
Tenor
Bass
Instrumentierungsdetails:
kleine Flöte
1. Flöte
2. Flöte
1. Oboe
2. Oboe
Englischhorn
1. Klarinette in B (+ Kl.(A))
2. Klarinette in B (+ Kl.(A))
kleine Klarinette in D (od. Kl.(Es))
Bassklarinette in B
1. Fagott
2. Fagott
Kontrafagott
1. Horn in F
2. Horn in F
3. Horn in F
4. Horn in F
1. Trompete in C (+ Trp.(B))
2. Trompete in C
3. Trompete in C
1. Posaune
2. Posaune
3. Posaune
Basstuba
Pauken
Schlagzeug
Orgel
Violine I
Violine II
Viola
Violoncello
Kontrabass
Schmidt - Das Buch mit 7 Siegeln für Soli, gemischten Chor, Orgel und Orchester
Gedruckt/Digital
Übersetzung, Abdrucke und mehr
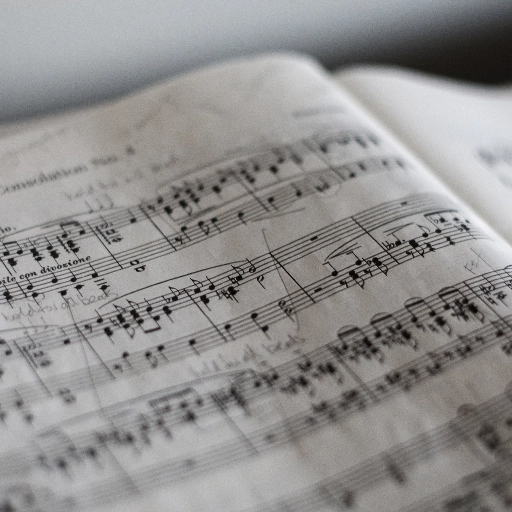
Franz Schmidt
Chorstimme: Alt (Das Buch mit 7 Siegeln)Instrumentierung: für Soli: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor SATB, Orgel und Orchester
Ausgabeart: Chorstimme
Sprache: Deutsch
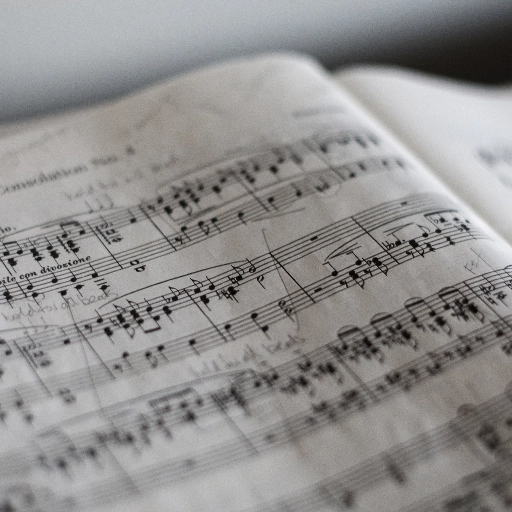
Franz Schmidt
Chorstimme: Bass (Das Buch mit 7 Siegeln)Instrumentierung: für Soli: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor SATB, Orgel und Orchester
Ausgabeart: Chorstimme
Sprache: Deutsch
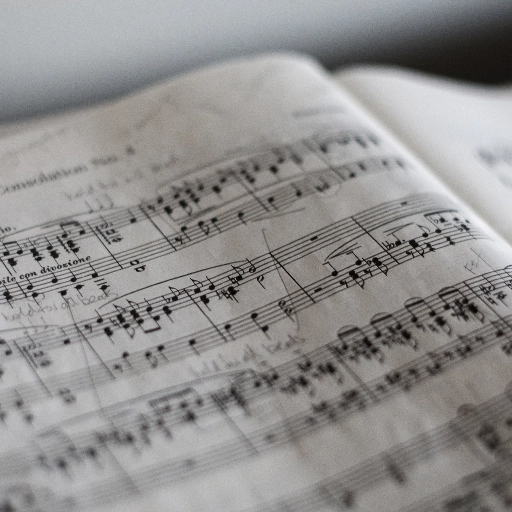
Franz Schmidt
Chorstimme: Sopran (Das Buch mit 7 Siegeln)Instrumentierung: für Soli: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor SATB, Orgel und Orchester
Ausgabeart: Chorstimme
Sprache: Deutsch
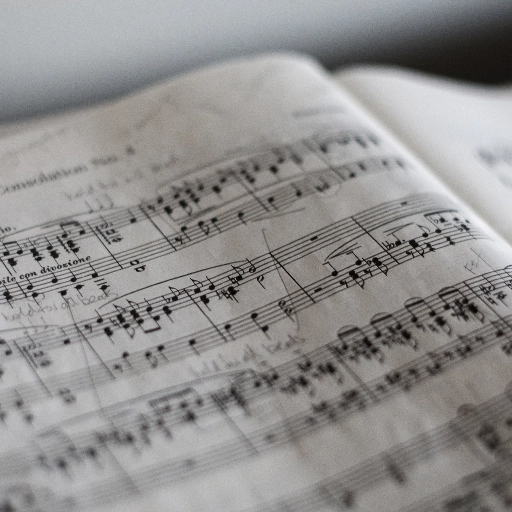
Franz Schmidt
Chorstimme: Tenor (Das Buch mit 7 Siegeln)Instrumentierung: für Soli: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor SATB, Orgel und Orchester
Ausgabeart: Chorstimme
Sprache: Deutsch
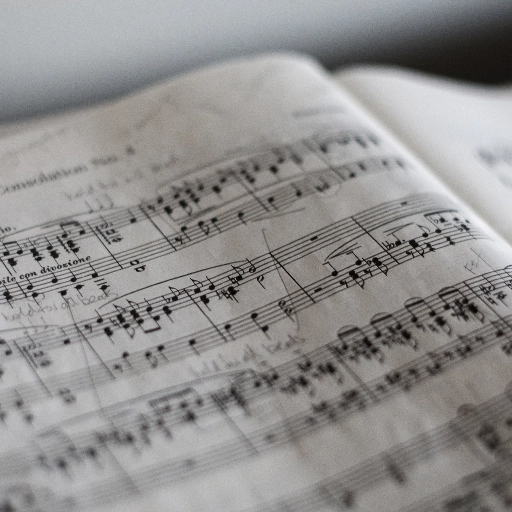
Franz Schmidt
Schmidt: Das Buch mit 7 SiegelnInstrumentierung: für Soli, gemischten Chor, Orgel und Orchester
Ausgabeart: Dirigierpartitur
Sprache: Deutsch
Print-On-Demand
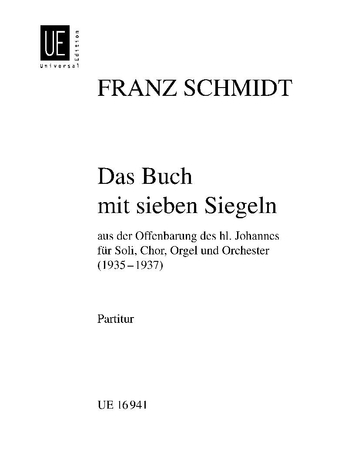
Franz Schmidt
Schmidt: Das Buch mit 7 Siegeln für Soli: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor SATB, Orchester und OrgelInstrumentierung: für Soli: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor SATB, Orchester und Orgel
Ausgabeart: Partitur
Sprache: Deutsch | Englisch

Franz Schmidt
Schmidt: Das Buch mit 7 Siegeln für Soli: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor SATB, Orgel und OrchesterInstrumentierung: für Soli, gemischten Chor (SATB), Orgel und Orchester
Ausgabeart: Klavierauszug
Sprache: Deutsch
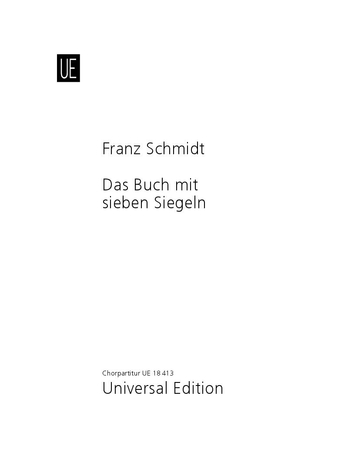
Franz Schmidt
Schmidt: Das Buch mit 7 Siegeln für Soli: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor SATB, Orgel und OrchesterInstrumentierung: für Soli, gemischten Chor (SATB), Orgel und Orchester
Ausgabeart: Chorpartitur
Sprache: Deutsch
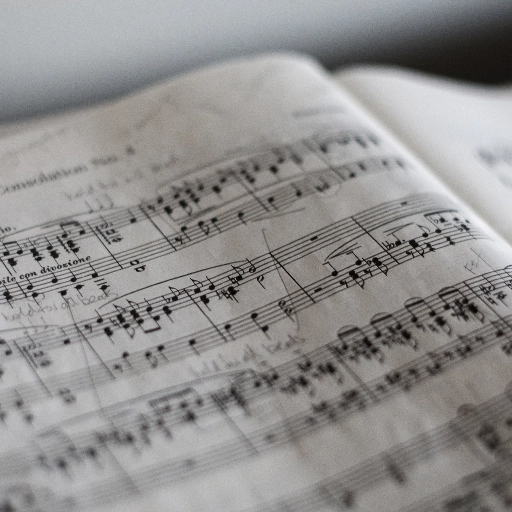
Franz Schmidt
Schmidt: Das Buch mit 7 Siegeln / The book with 7 seals für Soli: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor SATB, Orgel und OrchesterInstrumentierung: für Soli: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor SATB, Orgel und Orchester
Ausgabeart: Chorpartitur
Sprache: Englisch (Großbritannien)
Musterseiten
Hörbeispiel
Werkeinführung
Das Oratorium Das Buch mit sieben Siegeln ist Franz Schmidts letztes vollendetes Werk. Der Untertitel heißt: Aus der Offenbarung des Johannes, und der Evangelist (gesungen von einem Heldentenor) spielt die Hauptrolle im fast zweistündigen Werk, das für vier weitere Solisten, großen Chor, Orgel und Orchester besetzt ist. In seinem Vorwort bezeichnet der Komponist sein Werk als ein Oratorium über die „fundamentale Antithese” von Gut und Böse. Musikalisch werden sie als Wohlklang und Dissonanz gegenüber gestellt.
Franz Schmidts Opus summum hat sich in der ganzen Welt durchgesetzt, mit – teilweise szenischen – Aufführungen überall in Europa, sowie auch in den USA, Japan und China. Des Komponisten Wunsch ist in Erfüllung gegangen: „…Wenn es meiner Vertonung gelingt, diese beispiellose Dichtung, deren Aktualität jetzt, nach achtzehneinhalbhundert Jahren, so groß ist wie am ersten Tage, dem Hörer von heute innerlich nahe zu bringen, dann wird dies mein schönster Lohn sein.”
Bálint Varga
Einige Bemerkungen zum Text des Oratoriums Das Buch mit sieben Siegeln
Meines Wissens ist mein Versuch, die Apokalypse zusammenhängend zu vertonen, der erste, der bisher unternommen wurde; einzelne dazu besonders geeignete Stellen wurden allerdings schon wiederholt komponiert. Als ich an diese Riesenaufgabe herantrat, war mir klar, dass die Voraussetzung dazu darin lag, den Text auf eine Form zu bringen, die alles wesentliche womöglich dem Wortlaute nach beibehielt und dabei die geradezu unübersehbaren Dimensionen des Werkes auf durchschnittlichen Menschenhirnen fassbare Maße brachte. Dabei sollte der Bau in seinen äußeren Umrissen und inneren Zusammenhängen intakt bleiben. Mit Ausnahme des Umstandes, dass ich die Briefe des Johannes an die sieben Gemeinden zu einer Begrüßungsansprache vereinigte, hielt ich mich zunächst ganz an das Original; die Berufung des Johannes durch den Herrn, sein Erscheinen vor dem Thron, die Huldigungszeremonie, das Buch in der Hand des Herrn, die Vision des Lammes, das Entgegennehmen des Buches durch das Lamm, all dieses ist beinahe im Wortlaut dem Original nachgebildet. Der anschließende kurze Dankgottesdienst rundet den Akt zu einem „Prolog im Himmel” ab.
Der nun folgende erste Teil des Werkes bringt die Lösung der ersten sechs Siegel durch das Lamm: die Geschichte der Menschheit wird vorauserzählt. Nach segens- und hoffnungsreicher Ausbreitung der christlichen Heilslehre durch den weißen Reiter (Jesus Christus) und seine himmlischen Heerscharen verfällt die Menschheit in Nacht und Wirrsal; der blutrote Reiter überzieht die Welt mit seinen höllischen Heerscharen und stürzt die Menschheit in den Krieg aller gegen alle. Der dritte (schwarze) und der vierte (fahle) apokalyptische Reiter führen weiterhin die Folgen des Weltkrieges vor: Hungersnot und Pest. Die Menschheit ist zum größten Teil zugrunde gegangen und in Verzweiflung versunken: nur ein kleiner Rest hält noch am Glauben fest. Beim Aufbrechen des fünften Siegels treten die Seelen der Glaubensmärtyrer und anderer Opfer menschlicher Verbrechen in Erscheinung. Sie rufen nach Gerechtigkeit und Vergeltung. Der Herr heißt sie noch ausharren und verspricht ihnen Gerechtigkeit am Tage des großen Gerichtes. Da der größte Teil der noch übrigen Menschheit auch weiterhin in Sünde und Verstocktheit verharrt, vertilgt sie der Herr durch Erdbeben, Sintflut und Weltbrand, was durch das Aufbrechen des sechsten Siegels offenbar wird.
Damit schließt der erste Teil. Die sich hier ergebende Zäsur bot die einzige Gelegenheit, das im Original nunmehr wie ein Ozean alles überflutende Material in eine vertonbare Form zu bringen. Johannes führt nämlich von hier an in zahllosen Varianten und Wiederholungen von Gleichnissen und Bildern in ungeheurer Steigerung seinen Kampf gegen den Sündenpfuhl Babylon (gemeint ist das damalige kaiserliche Rom) bis zu dessen völliger Vernichtung, um den endgültigen Sieg des Christentums in der Vision von dem neuen Jerusalem aufzuzeigen und zu verherrlichen. Ich habe es nun gewagt, die beiden ersten Faktoren der Antithese Babylon – Jerusalem, Heidentum – Christentum, Verworfenheit – Tugendhaftigkeit usw. samt allem darauf bezüglichen Material auszuscheiden. Die fundamentale Antithese hat dadurch meinem Empfinden nach an Kraft und Bedeutung nichts eingebüßt, dafür aber wurde durch die enorme Abbürdung von Material der Bau eines proportionierten zweiten Teiles, und zwar ganz im Sinne des Originals, möglich.
Der zweite Teil beginnt mit der großen Stille im Himmel, die beim Öffnen des siebenten Siegels eingetreten ist. Während dieser Stille erzählt uns Johannes gleichsam in Parenthese die Geschichte des wahren Glaubens und seiner Kirche von der Geburt des Heilands angefangen, von ihren Kämpfen gegen die Anhänger des Teufels und deren falsche Lehren und von ihrem endgültigen Sieg.
Nach dem großen Schweigen im Himmel, das bis an das Ende aller irdischen Zeit während anzunehmen ist, rüsten die sieben Posaunenengel zum Blasen des schauerlichen Appells für das Jüngste Gericht. Über dieses selbst berichtet Johannes wie im Original nur kurz, um aber umso eindringlicher darzulegen, dass die Weltenwende angebrochen sei, dass nunmehr eine neue Erde jene trage, die das ewige Leben haben und dass ein neuer Himmel über ihnen blaue. Und der Herr spricht zu den Geläuterten, dass er mit ihnen wohnen wird und sie seine Kinder sein werden und er ihr Vater. Nachdem die Geläuterten dem Herrn mit Halleluja gedankt und gehuldigt haben, schließt Johannes seine Offenbarung mit einer kurzen, erläuternden Abschiedsansprache ab.
Ich habe mich also, mit Ausnahme der oben einbekannten Elision, genau an das Original gehalten und habe zu dem Werk einzig vom Standpunkte des tiefreligiösen Menschen und des Künstlers aus Stellung genommen. Diese Stellungnahme mag auch manche Freiheit in der Auffassung erklären: so zum Beispiel, dass ich Johannes, der zur Zeit der Abfassung der Apokalypse ein hochbetagter Greis war, als jungen Mann auffasse und komponiere, dessen Musik mit dem Temperament eines solchen interpretiert. Über die
Musik selbst seien mir lediglich einige das Formale betreffende Bemerkungen gestattet.
Da der Text die Funktion hat, das Knochengerüst der Komposition abzugeben und somit nicht nur die äußeren Konturen des Werkes bestimmt, sondern auf das Wachstum aller seiner Organe maßgebenden Einfluss nimmt, so erscheint die vokale Komponente des Werkes als die primäre seiner Gesamtentwicklung. Ich war nur bestrebt, von diesem Gesichtspunkte aus die künstlerischen Aufgaben auf alle am Aufbau des Werkes mitarbeitenden Kräfte in möglichst gleichem Maße zu verteilen. Daraus folgt zum Beispiel, dass dem Orchester zwar durchaus keine untergeordnete, aber auch keine prävalierende Rolle zufällt. Es begleitet durchgehend im hochdramatischen Stil, hat auch gelegentlich tonmalerische Aufgaben zu lösen; dagegen hat es keine selbständigen symphonischen Sätze, wie Vor- und Zwischenspiele, auszuführen; diese habe ich vielmehr der Orgel zugeteilt, die in diesem Werke grundsätzlich als souveräner Klangkörper behandelt wird und nicht etwa bloß im Orchester mitwirkt.
Die Disposition der Gesangspartien ist in großen Zügen folgende: Johannes, der zwischen den beiden musikalisch gleichlautenden Ansprachen (Begrüßung und Abschied) seine Offenbarung vorträgt, wird darin von den vier Solisten und den Chören, die teils als handelnde Personen, teils als Miterzähler eingreifen, unterstützt. Von den Solopartien ist die Stimme des Herrn (Bass) die prominenteste. Sie ertönt dreimal: gleich zu Anfang zur Berufung des Johannes, dann im ersten Teil zur Besänftigung des Aufruhrs im Himmel und endlich im zweiten Teil zur Verkündigung der Heils- und Gnadenbotschaft. Außer diversen Quartett- und Ensemblesätzen (als Engel und dergleichen) haben die Solisten im ersten Teil zwei Duoszenen auszuführen, und zwar die von Mutter und Tochter (Sopran und Alt) und die der beiden Überlebenden auf dem Leichenfelde (Tenor und Bass). Die Chöre, über das ganze Werk verteilt und verschiedenartig beschäftigt, haben folgende wichtige selbständige Sätze auszuführen: im Prolog die Vision des Lammes (mit Tenorsolo), weiterhin Schlusschor. Im ersten Teil: „der König der Könige”; der Krieg; der Aufruhr im Himmel; der Weltuntergang. Im zweiten Teil: Der Appell zum Jüngsten Gericht (Quadrupelfuge) und endlich Halleluja.
Diese knappen Andeutungen dürften genügen, um das Verstehen des Werkes beim ersten Hören zu erleichtern; und wenn es meiner Vertonung gelingt, diese beispiellose Dichtung, deren Aktualität jetzt, nach achtzehneinhalbhundert Jahren, so groß ist wie am ersten Tage, dem Hörer von heute innerlich nahe zu bringen, dann wird dies mein schönster Lohn sein.
Franz Schmidt, geschrieben zur Uraufführung am 15. Juni 1938
