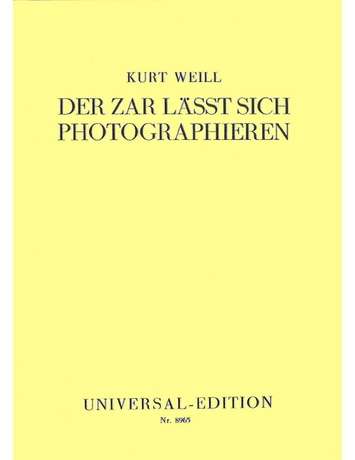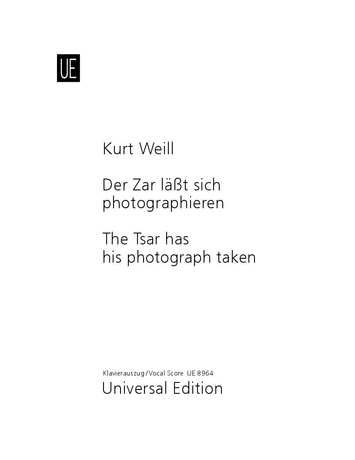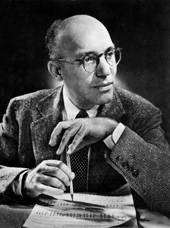
Kurt Weill
Der Zar lässt sich photographieren
Kurz-Instrumentierung: 2 2 2 2 - 3 2 2 0 - Pk, Schl, Klav, Str, Tonband für „Tango Angèle“
Dauer: 60'
Libretto von: Georg Kaiser
Übersetzer: Michel Ancey, Lionel Salter
Chor: TB
Rollen:
Der Zar
Bariton / Angèle
Sopran / Der Gehilfe
Tenor / Der Boy
Alt / Die falsche Angèle
Sopran / Der falsche Gehilfe
Tenor / Der falsche Boy
Alt / Der Anführer
Tenor / Der Begleiter des Zaren
Baß / Zwei Kriminalbeamte
Sprechrollen
Instrumentierungsdetails:
1. Flöte (+Picc)
2. Flöte (+Picc)
1. Oboe
2. Oboe (+Eh)
1. Klarinette in B
2. Klarinette in B
1. Fagott
2. Fagott (+Kfg)
1. Horn in F
2. Horn in F
3. Horn in F
1. Trompete in C
2. Trompete in C
1. Posaune
2. Posaune
Pauken
Schlagzeug
Klavier
Violine I
Violine II
Viola
Violoncello
Kontrabass
Tonband für „Tango Angèle“
Weill - Der Zar lässt sich photographieren
Musterseiten
Hörbeispiel
Werkeinführung
Kurt Weills Einakter Der Zar lässt sich photographieren war nach der Dreigroschenoper lange die erfolgreichste Oper des Komponisten und wurde in über 25 Inszenierungen nachgespielt. Sie ist Weills erste komische und seine letzte „durchkomponierte“ Oper. Weill hatte geplant, eine abendfüllende Ergänzung mit buffoneskem Charakter zu seinem Protagonisten zu komponieren, ein „gegensätzliches Werk anderen Genres, doch an Spannung und Wirksamkeit diesem nicht nachstehend.“, wie er schrieb. Das Deutsche Kammermusikfest Baden-Baden hatte Weill einen neuen Auftrag erteilt, woraufhin er sich an Georg Kaiser, mit dem er bereits beim Protagonisten zusammengearbeitet hatte, für ein Libretto wandte. Weill erinnerte sich: „Während eines Sommeraufenthaltes im Hause Georg Kaiser erinnerte ich Kaiser an eine Idee von einem Fotografenkasten mit eingebautem >Maschinengewehr<, die er einmal scherzhaft geäußert hatte. […] In wenigen Tagen entwarfen wir gemeinsam das Szenarium.“ Da der Zar letztendlich den Rahmen des Baden-Badener Festivals sprengte, schrieb Weill hierfür stattdessen das Mahagonny Songspiel.
Wie Ernst Krenek in Jonny spielt auf nutzte Weill im Zar die neuen technischen Errungenschaften seiner Zeit: Ein Fotoatelier mit Inventar, ein Telefon, eine Türklingel und ein Grammophon, auf dem der eigens hierfür vorproduzierte Tango Angèle abgespielt wird. Weill bindet popularmusikalische Elemente in seine Komposition mit ein, etwa den Foxtrott. Ein Herrenchor kommentiert das parodistische Geschehen.
In Angèles Pariser Fotostudio klingelt das Telefon: Der Zwar will sich von ihr fotografieren lassen, am besten sofort. Als es kurz darauf an der Tür klingelt, steht da jedoch nicht der Zar, sondern eine Gruppe Verschwörer, die den Herrscher bei dieser Gelegenheit umbringen will. Sie überwältigen Angèle und verstecken eine Pistole in ihrem Fotoapparat. Als der Zar ins Studio kommt entspinnt sich ein Wechselspiel zwischen ihm und der falschen Angèle, von deren Schönheit er betört ist, bis seine Leibwächter eintreten und ihn vor einem Anschlag auf ihn warnen. Die Verschwörer, fast enttarnt, türmen schließlich, die echte Angèle wird befreit und endlich kann sich der Zar fotografieren lassen.