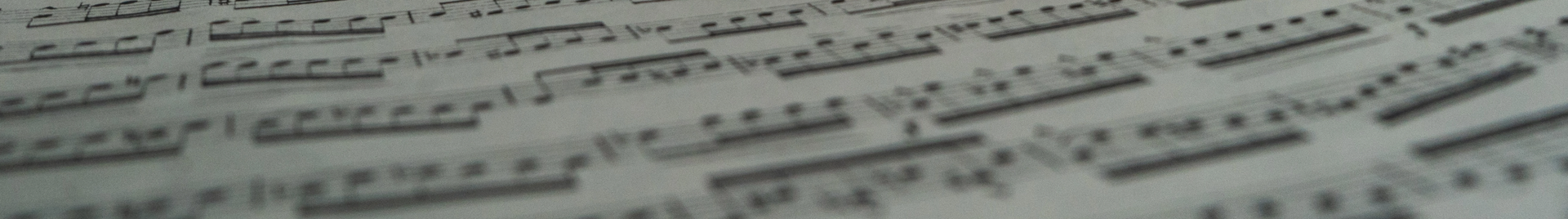

Peter Ronnefeld
Nachtausgabe
Kurz-Instrumentierung: 1 1 1 1 - 1 2 1 0 - Pk, Schl(2), Klav, Str (solistisch)
Bearbeitet von: Ernst Märzendorfer
Text von: Peter Ronnefeld
Text bearbeitet von: Richard Bletschacher
Rollen:
Emma Bachofen
Zimmervermieterin ... Bass
Anna Pachulke
ihre Freundin ... Sopran
Renée Pachulke
deren Tochter ... hoher Sopran
Lothar Witzlaff
Student und Dichter ... Bariton
Mario Caraccini
Student und Maler ... Tenor
Ping Schma Fu
Student und Photograph ... Tenor
Dr. Erich Stielicke
Chefredakteur der „Nachtausgabe“ ... Tenor
Karin Mikoleit
seine Sekretärin ... Mezzosopran
Sternhagel
ein Wachtmeister ... Bariton
Stramm
ein Kommissar ... Bariton
vier jugendliche Zeitungsausrufer:
1) Frauke ... Sopran
2) Wibke ... Sopran
3) Heike ... Mezzosopran
4) Hauke ... Tenor
Instrumentierungsdetails:
Flöte (+Picc)
Oboe (+Eh)
Klarinette in B (+Bkl)
Fagott
Horn in F
1. Trompete in C
2. Trompete
Tenorposaune
Pauken
1. Schlagzeug
2. Schlagzeug
Klavier
1. Violine
2. Violine
Viola
Violoncello
Kontrabass
Ronnefeld - Nachtausgabe
Musterseiten
Hörbeispiel
Werkeinführung
Peter Ronnefeld komponierte seine Kammeroper Nachtausgabe im Alter von nur 20 Jahren, zwischen 1955–56. Es war nicht sein erstes Bühnenwerk, wobei von früheren nur Fragmente vorhanden sind. Zur damaligen Zeit unterrichtete Ronnefeld bereits am Mozarteum in Salzburg und schrieb Nachtausgabe in erster Linie zu Studienzwecken für seine Studenten der Internationalen Sommerakademie. Inhaltlich ist diese kurze, moderne Opera buffa zeitlos. Es geht um reißerische Geschichten und Klatsch [&] Tratsch in den Boulevardmedien, involvierte Personen, sowie die Leser der Revolverblätter.
Dem Thema nähert sich der hochbegabte Ronnefeld musikalisch und sprachlich auf scharfsinnige, freche, ironisch-witzige Weise, was einem wichtigen Charakterzug des Komponisten entspricht. Im Gespräch erwähnen Zeitgenossen immer seinen glänzenden Humor, den offensichtlich alle in Erinnerung behalten haben. Selbst Thomas Bernhard, der bei der Uraufführung eine Sprechrolle hatte, hat laut eigener Aussage nachher nie mehr so viel gelacht wie zu jener Zeit, mit einem seiner besten Freunde, Peter Ronnefeld. [1]
Musikalisch ist der Einfluss seines ehemaligen Lehrers Boris Blacher, den er sehr verehrte, durchaus zu erkennen. Die freitonale Komposition wartet mit einfallsreichen Ideen auf. So, wenn zum Beispiel der telefonierende Reporter als Sänger vom Orchester durch ein klangliches Stimmengewirr die Antworten in seinem Gespräch erhält. Pointen werden oft nicht verbal, sondern instrumental im Ensemble aufgelöst. 1987 wurde das Werk von Ernst Märzendorfer überarbeit. Die Substanz wurde dabei nicht angetastet, die Oper aber auf behutsame Weise „harmonisiert“. Eine Sekretärin bekam beispielsweise eine Mezzopartie, Bernhards Sprechrolle bei der Uraufführung wurde nun gesungen und es fand eine stellenweise Umgruppierung der Musik statt. Bei der Aufführung dieser Neufassung 1987, auf der Studiobühne der Wiener Staatsoper im Künstlerhaus, war die Presse einhellig begeistert. Zahlreiche österreichische und deutsche Medien lobten Werk und Ausführende in den höchsten Tönen.
Thomas Bernhard an die Süddeutsche Zeitung am 20. Februar 1987. Der Leserbrief
erschien unter dem Titel „…allerdings nur als Baß-Stimmführer“
