

Arnold Schönberg
6 Orchesterlieder
Dauer: 25'
Schönberg - 6 Orchesterlieder für Gesang und Orchester
Übersetzung, Abdrucke und mehr
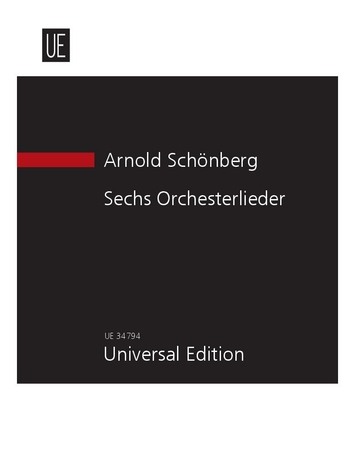
Arnold Schönberg
Schönberg: 6 Orchesterlieder für Gesang und Orchester - op. 8Instrumentierung: für Gesang und Orchester
Ausgabeart: Studienpartitur
Sprache: Deutsch
Werkeinführung
Im Spätsommer 1903 kehrte Arnold Schönberg nach einem kompositorisch ertragreichen, beruflich jedoch weitgehend erfolglosen, eineinhalbjährigen Aufenthalt mit Frau und Tochter aus Berlin nach Wien zurück. Der Vertrag als Kapellmeister des literarischen „Überbrettl”-Kabaretts an Ernst von Wolzogens Berliner „Buntem Theater”, das trotz anfänglicher Popularität bei der feinen Berliner Gesellschaft ein wirtschaftlicher Misserfolg wurde, lief bereits nach einer Saison aus. Die auf Intervention von Richard Strauss zustande gekommene Unterrichtstätigkeit am „Stern’schen Konservatorium” war auf nur ein Semester beschränkt. Durch Vermittlung seines Schwagers Alexander Zemlinsky (bis 1906 künstlerischer Leiter des Carltheaters) nahm die Auftragslage für Schönberg in Wien eine positive Wendung, wenngleich hinter der praktischen Beschäftigung – Instrumentationen, Arrangements für Klavier zu zwei oder vier Händen (darunter Rossinis Der Barbier von Sevilla, Lortzings Waffenschmied sowie Schuberts Rosamunde für die Universal Edition) – die kompositorische Tätigkeit weitgehend in den Hintergrund trat.
Nach den in Berlin begonnenen und in Wien abgeschlossenen Klavierliedern op. 3 sowie einem unvollendeten Chorlied mit Orchester (Darthulas Grabgesang) wandte sich Schönberg im Herbst 1903 einem – sieht man von dem in Particellform erhaltenen Fragment Gethsemane für eine Männerstimme und Orchester aus dem Jahr 1899 ab – für ihn neuen Genre zu: dem Orchesterlied. Wie bereits in Opus 3 griff er zunächst wieder auf Texte aus Des Knaben Wunderhorn zurück und begann Ende November 1903 mit der ersten Niederschrift von Das Wappenschild (abgeschlossen im April 1904). Es folgte das Lied Natur nach einem Text von Heinrich Hart (komponiert zwischen 18. Dezember 1903 und 7. März 1904; diese Komposition liegt auch in einer unvollendeten Fassung für Gesang und Klavier vor) und die Petrarca-Verton- ung Nie ward ich, Herrin, müd’ (eine erste Niederschrift datiert mit Juni 1904).
Die Sommermonate 1904 verbrachte Schönberg bei den Eltern seines Jugendfreundes David Josef Bach in Mödling. Dort arbeitete er unter anderem auch an den Orchesterliedern op. 8. Am 3. Juli schloss Schönberg die Partiturreinschrift von Nie ward ich, Herrin, müd’ ab. Bei der in einem Brief vom 14. Juli an den Obmann der „Vereinigung schaffender Tonkünstler”, Oskar Posa, angesprochenen Komposition dürfte es sich – der Quellenchronologie nach zu schließen – um Voll jener Süße nach einem Text von Petrarca handeln: „Ich habe ein neues Lied für Orchester (das 4te) angefangen. Ich glaube, das wird sehr gut werden! Ich habe mir diesmal die Aufgabe gestellt, mit allen Stimmführungskünsten auch die Instrumentationskünste zu vereinigen. Ich hoffe, daß es gelingt.” Im Wintersemester 1904/1905 unterrichtete Schönberg an den „Schwarz- wald’schen Schulanstalten” in der Wallnerstraße. An das ehemalige Mädchen-Lyzeum war 1904 eine Koedukationsschule sowie ein Fortbildungskurs zur Förderung künstlerischer Begabungen angeschlossen worden. Neben seiner Lehrtätigkeit arbeitete Schönberg an einem Streichquintett in D-Dur (als Fragment überliefert), vollendete im November 1904 das in Mödling begonnene Voll jener Süße und komponierte an Wenn Vöglein klagen sowie Sehnsucht (abgeschlossen am 6. April 1905).
Erst zehn Jahre nach der Entstehung des ersten Orchesterliedes und beinahe zeitgleich mit der Komposition des ersten Liedes aus Opus 22 (der einzigen weiteren Komposition dieser Gattung in Schönbergs Schaffen) – erfolgte die Drucklegung der „genauestens revidierten” Partituren von Opus 8 im Oktober 1913 als Einzelausgaben bei der Universal Edition. Bereits im März 1911 war der von Anton Webern erstellte Klavierauszug im selben Verlag erschienen. Anlässlich einer geplanten Uraufführung von drei Liedern aus Opus 8 unter Alexander Zemlinskys Leitung in Prag schrieb Schönberg am 14. Juli 1913 seinem Schwager: „Wenn ich Wünsche äußern soll, so läge mir mehr an den vier Tenorliedern, als an den zwei übrigen (Natur und Sehnsucht). Das wirkungsvollste ist wohl ‚Wappenschild’. Aber ich glaube die Petrarca- Lieder sind die besten.” Zemlinsky kam seinem Wunsch nach und dirigierte bei der Uraufführung am 29. Jänner 1914 Das Wappenschild sowie die Petrarca-Lieder Voll jener Süße und Wenn Vöglein klagen, den Gesangspart übernahm der Heldentenor Hans Winkelmann (Sohn des ersten Bayreuther „Parsifal” Hermann Winkelmann). Arnold Schönberg, der dem Ereignis beiwohnte und Zemlinsky zuvor daran erinnert hatte, dass Winkelmann „p und vor allem legato singen [...] und den Text nicht allzu scharf sprechen” solle, schrieb ihm wenige Tage danach aus Leipzig: „Du weißt, daß ich mir in der Interpretation manches abweichend von deiner Auffassung gedacht hatte. Aber die Interpretation ist das Zeitliche, das Veränderliche am musikalischen Kunstwerk. Sie ist eine der Methoden, den Sinn darzulegen, den Geist zur Auferstehung zu erwecken.”
Therese Muxeneder, Wien, November 1998
