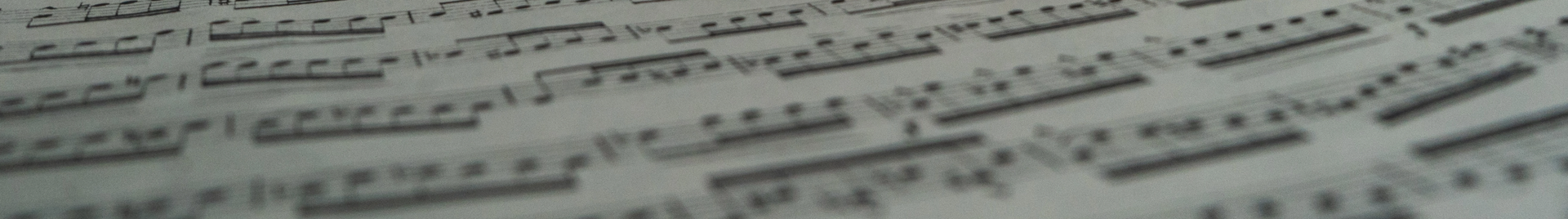

Hans Gál
Die heilige Ente
Kurz-Instrumentierung: 3 3 3 3 - 4 3 3 1 - Tiefe Glocken (Bühnenmusik), Gong (Bühnenmusik), Pauken (Bühnenmusik), Trompete (Bühnenmusik), Posaune (Bühnenmusik), Pk, Schl, Hf, Cel, Str(9 8 7 6 5)
Dauer: 180'
Gesangstext: Karl M. von Levetzow, Leo Feld
Chor: SATB
Rollen:
Der Mandarin
Bariton / Li
seine Gemahlin
Sopran / Der Kuli Yang
Tenor / Die Tänzerin
Sopran / Der Gaukler
Baßbuffo / Der Bonze
Baß / Der Haushofmeister
Tenorbuffo / Drei Götter: Baß
Tenor
Bariton
Instrumentierungsdetails:
1. Flöte
2. Flöte
3. Flöte (+Picc)
1. Oboe
2. Oboe
3. Oboe (+Eh)
1. Klarinette in A, B
2. Klarinette in A, B
3. Klarinette in A, B (+Bkl)
1. Fagott
2. Fagott
3. Fagott
1. Horn in F
2. Horn in F
3. Horn in F
4. Horn in F
1. Trompete in C
2. Trompete in C
3. Trompete in C
1. Posaune
2. Posaune
3. Posaune
Basstuba
Pauken
Schlagzeug
Harfe
Celesta
Violine I(9)
Violine II(8)
Viola(7)
Violoncello(6)
Kontrabass(5)
Tiefe Glocken (Bühnenmusik)
Gong (Bühnenmusik)
Pauken (Bühnenmusik)
Trompete (Bühnenmusik)(3)
Posaune (Bühnenmusik)(3)
Gál - Die heilige Ente
Hörbeispiel
Werkeinführung
Nachdem Hans Gál mit seiner Erstlingsoper Der Arzt der Sobeide in Breslau 1919 einen bemerkenswerten Erfolg errang, fand sich vier Jahre darauf das Düsseldorfer Stadttheater bereit, die zweite Oper des Komponisten zur Uraufführung anzunehmen. Diese dreiaktige Oper, die sich schon durch ihren geistreich-anmutigen Text empfahl, fand unter der Leitung von Georg Széll eine so freundliche Aufnahme, dass eine ganze Reihe deutscher Opernbühnen sie sogleich in ihren Spielplan aufnahmen. Die beiden ersten Opern Gáls gehören zum heiteren Genre. Die heilige Ente schwebt in einer Atmosphäre von Humor und Ironie.
Hans Gutman schreibt im Anbruch 1925 anlässlich der Berliner Erstaufführung: Die Harmonik dieser Partitur ebenso wie ihre Klangfarben zeigen das Orchester, wie es sich im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt hat, um dann von Meistern wie Strauss und Mahler virtuos gehandhabt zu werden. Auch Gál versteht es, mit den Mitteln dieses großen Klangkörpers umzugehen, das exotische Milieu der Handlung harmonisch durch Quinten und Oktaven (die anerkannten Anzeichen solcher Umgebung) sowie Verwendung der Ganztonleiter anzudeuten, während er durch den Gong die Bonzenfeierlichkeit seines Stoffes zu betonen weiß. Die Partitur klingt, die vokale Melodik ist nicht (wie so oft in der nach-wagnerischen Produktion) gegen die Singstimmen geschrieben.
Synopsis: Der einfache Entenzüchter Yang lässt sich auf dem Weg zum Palast des Mandarins, wo er eine Ente für den abendlichen Festschmaus abliefern muss, durch die Schönheit und den Gesang der Gattin des Mandarins verzaubern. So bemerkt er nicht, dass ihm die Ente gestohlen wird. Als das Fest beginnt, droht der Mandarin Yang mit der Todesstrafe, falls dieser die Ente nicht herbeischafft. Da greifen die Götter ein und vertauschen die Seele von Yang mit der des Mandarins. Yang schafft als Mandarin die Todesstrafe ab; als er jedoch auch die Götter für überflüssig erklärt, wird es diesen zu bunt: Sie machen den Seelentausch rückgängig…
